Bildquelle: Phuchit / iStock / Getty Images Plus
Das Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißen (LLH) ist ein leistungsfähiges Verfahren, das sich insbesondere für die industrielle Serienfertigung eignet – überall dort, wo höchste Anforderungen an Nahtqualität, Produktivität und minimale Verzüge bestehen.
Für das Schweißpersonal und die Schweißaufsicht, die sich mit hybriden Laserstrahl-Lichtbogen-Schweißverfahren beschäftigen, definiert das Merkblatt 3216 Prozesse, beschreibt technische Parameter und zeigt Potenziale und physikalische Zusammenhänge auf.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug. Den vollständigen Beitrag finden Sie im Produkt „Die Schweißaufsicht im Betrieb“.
Inhaltsverzeichnis
Gemeinsames Schmelzbad
Gemäß der Norm DIN EN ISO 12932 „Schweißen – Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißen von Stählen, Nickel und Nickellegierungen – Bewertungsgruppen für Unregelmäßigkeiten“ gelten solche Schmelzschweißverfahren als „hybrid“, bei denen ein gemeinsames Schmelzbad entsteht – also eine echte Kopplung der Energiequellen in einer klar abgegrenzten, gemeinsamen Prozesszone. Damit unterscheiden sich hybride Verfahren von reinen Verfahrenskombinationen, bei denen zwei getrennte Schmelzbäder nacheinander oder nebeneinander existieren und durch feste Werkstoffbereiche voneinander abgegrenzt sind.
Schweißtechnologien, bei denen ein Laserstrahl mit mindestens einem Lichtbogen gekoppelt ist, bezeichnet man als Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißverfahren (LLH-Verfahren) bzw. Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißprozesse. Wichtig ist, dass die Begriffe „Prozess“ und „Verfahren“ nicht gleichbedeutend sind.
Der „Prozess“ beschreibt den Ablauf der physikalischen und metallurgischen Vorgänge, insbesondere im Zusammenhang mit der Energieeinbringung in die Fügezone.
Das „Verfahren“ hingegen umfasst die Gesamtheit aller technischen Maßnahmen, die man zur Lösung der Fügeaufgabe einsetzt.
Verfahrensvarianten
Entsprechend den verfügbaren Strahlquellen und den etablierten Lichtbogenschweißverfahren gibt es die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten hybriden Verfahrensvarianten:
| CO2-Laser | Festkörperlaser | |
|---|---|---|
| WIG | CO2-Laserstrahl-WIG-Hybridschweißverfahren | Festkörper-Laserstrahl-WIG-Hybridschweißverfahren |
| MSG | CO2-Laserstrahl-MSG-Hybridschweißverfahren | Festkörper-Laserstrahl-MSG-Hybridschweißverfahren |
| UP | CO2-Laserstrahl-Unterpulver-Hybridschweißen | Festkörper-Laserstrahl-Unterpulver-Hybridschweißverfahren |
| Plasma | CO2-Laserstrahl-Plasma-Hybridschweißverfahren | Festkörper-Laserstrahl-Plasma-Hybridschweißverfahren |
Mit dem technischen Fortschritt bei Leistung und Strahlqualität qualifizieren sich auch Diodenlaser zunehmend für hybride Kopplungen.
In der Praxis sind vor allem serielle Anordnungen verbreitet, bei denen Laserstrahl und Elektrode in Reihe positioniert sind. Alternativ existieren auch koaxiale Konfigurationen. Der Laserstrahl wird dabei möglichst senkrecht zur Werkstückoberfläche geführt.
Bei serieller Kopplung kann die Elektrode sowohl
- stechend (meist hinter dem Laserstrahl, also in Schweißrichtung) als auch
- schleppend (in der Regel vor dem Laserstrahl)
ausgerichtet sein. Die Arbeitspositionen der LLH-Verfahren werden analog zu den Einzelverfahren gemäß DIN EN ISO 6947 „Schweißen und verwandte Prozesse – Schweißpositionen“ angegeben. Neben Anordnungen, bei denen Laserstrahl und Elektrode auf derselben Werkstückseite geführt werden, gibt es auch Varianten, bei denen die Elektrode auf der gegenüberliegenden Seite in Nähe der Keyhole-Öffnung positioniert ist. In solchen Fällen ist die Arbeitsposition auf das dominante Prozessmerkmal zu beziehen.
Ein relevanter Unterschied zwischen CO2-Lasern und Festkörper- bzw. Diodenlasern liegt in der Wechselwirkung mit dem Schweißplasma:
- Beim CO2-Laser kann bei ausreichender Leistungsdichte ein Plasma aus Metalldampf und Prozessgas entstehen.
- Festkörper- und Diodenlaser erzeugen dagegen nur einen heißen, leuchtenden Metalldampf, ohne ausgeprägte Plasmabildung.
Die CO2-Laserstrahlung wird vom Plasma deutlich stärker absorbiert oder abgelenkt als die Strahlung von Festkörperlasern, was zu unterschiedlichen Wechselwirkungen in der gemeinsamen Prozesszone des Hybridschweißens führt.
Zum Schutz der optischen Komponenten im Strahlengang vor Schweißrauch und Spritzern können sog. Cross-Jets (Querstrom-Luftdüsen) eingesetzt werden.
Tipp der Redaktion: Fachbuch „Schweißanweisung und Schweißverfahrensprüfung“
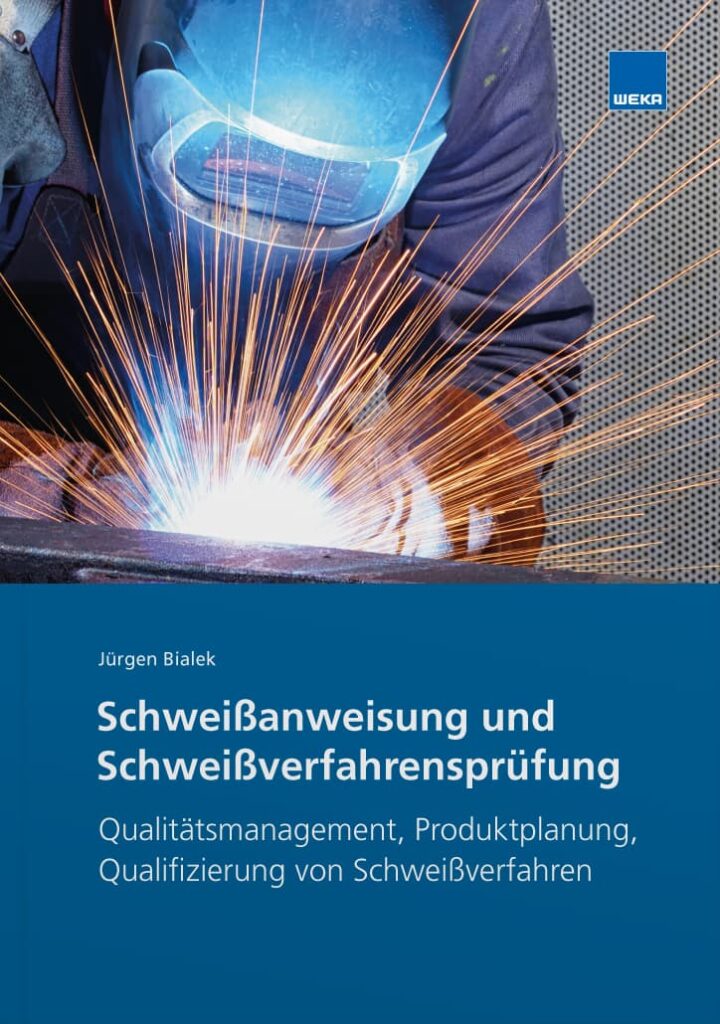
- Schweißen als spezieller Prozess und umfassender Qualitätsansatz
- Anforderungen aus Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung
- Die Schweißanweisung als Bestandteil der Produktplanung
- Qualifizierung von Schweißverfahren und die DIN EN 1090
- Die Schweißverfahrensprüfung
Parameter des Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißprozesses
Die hybride Prozesskopplung eröffnet zusätzliche Möglichkeiten zur Prozessoptimierung. Dies ermöglicht einen wirtschaftlich und technologisch sinnvollen Einsatz hybrider Schweißverfahren. Eine der zentralen Kenngrößen der LLH-Prozesse ist die relative Positionierung des Laserstrahls und zusätzlicher Energiequellen zueinander. Zur Beschreibung dieser Anordnung wird ein kartesisches xyz-Koordinatensystem verwendet, das sich ggf. mit der Schweißgeschwindigkeit mitbewegt. Es wird durch die Werkstückoberfläche bzw. eine Tangentialebene (x, y) zu dieser sowie eine darauf senkrechte z-Achse definiert.
Technologiepotenziale der Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißverfahren
Das Technologiepotenzial der LLH-Verfahren ergibt sich einerseits aus den hochentwickelten Technologien der Einzelverfahren, andererseits vor allem aus den Synergieeffekten einer Kopplung. Dadurch lassen sich verfahrensbedingte Einschränkungen sowohl des Laserstrahl- als auch des Lichtbogenschweißens überwinden.
Einzelverfahren
Die klassischen Vorteile des Lichtbogenschweißens umfassen:
- kostengünstige, konventionelle Energiequelle
- gezielte Beeinflussung der Wärmeführung
- gute Möglichkeiten zur Zugabe von Zusatzwerkstoff
- etwa zur Spaltüberbrückung und/oder
- zur metallurgischen Steuerung der Erstarrungsmorphologie
Diese Vorteile fließen uneingeschränkt in das Technologiepotenzial der LLH-Verfahren ein.
Das Laserstrahlschweißen zeichnet sich durch sehr hohe Schweißgeschwindigkeiten aus. Bei der Kopplung mit Lichtbogenschweißverfahren muss diese Geschwindigkeit jedoch an die Stabilitätsbedingungen des entstehenden Lichtbogenprozesses angepasst werden – unter Berücksichtigung der additiven Energieeinbringung und der prozessinternen Wechselwirkungen.
Die typischen Vorteile des Laserstrahlschweißens sind:
- hohe Schweißgeschwindigkeit
- geringe Streckenenergie
- große Einschweißtiefe
- eine tiefe, schmale Naht
Kopplung
Diese Merkmale übertragen sich nur mit Einschränkungen auf LLH-Verfahren. So geht etwa der Vorteil der stark konzentrierten Energieeinbringung beim reinen Laserstrahlschweißen bei der Kopplung zum Teil verloren. In LLH-Prozessen ist mit einer breiteren Wärmeeinflusszone (WEZ) und einem höheren Bauteilverzug als beim Laserstrahlschweißen zu rechnen. Die flexible Kopplung der Energiequellen stellt jedoch einen bedeutenden Freiheitsgrad zur gezielten Steuerung der Wärmeführung dar.
Über die additive Nutzung der Vorteile beider Einzelverfahren hinaus bietet die Prozesskopplung spezifische Vorzüge der LLH-Verfahren, die ein breites industrielles Anwendungsspektrum erschließen:
- Stabilisierung des Prozesses durch Wechselwirkungen
- Erhöhung des thermischen Wirkungsgrads
- erweiterte Schweißmöglichkeiten
Durch die zusätzliche Energie des Lichtbogens kann die Schweißgeschwindigkeit gegenüber dem reinen Laserstrahlschweißen um das Zwei- bis Dreifache gesteigert werden. Zudem lässt sich auch die Einschweißtiefe entsprechend vergrößern.
Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung der LLH-Verfahren ist die Vielzahl an Prozessparametern, die für eine belastbare Qualifizierung gezielt optimiert werden müssen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Wirkungen einzelner Einstellgrößen gegenseitig stark beeinflussen können.
Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Möglichkeiten der energetischen und geometrischen Einflussnahme – vor allem im Zusammenspiel mit dem Einsatz von Zusatzwerkstoffen – auf die Form und Strömungsverhältnisse des Schweißbads. Diese wirken sich unmittelbar auf die Nahtgeometrie sowie die Erstarrungsmorphologie aus.
Ein zentrales Ziel der Verfahrensoptimierung besteht zudem darin, den Prozess innerhalb eines stabilen Prozessfensters zu führen, das die erforderliche Prozesssicherheit sicherstellt. Hier zeigt sich, dass die Synergieeffekte der hybriden Prozesskopplung regelmäßig zu einer deutlich erhöhten Prozessstabilität beitragen.
Beispiel Laserstrahl-MSG-Hybridschweißverfahren: Einflussfaktoren und Vorteile
Beim Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen ist der Winkel zwischen Laserstrahl und Brennerachse eine entscheidende Einflussgröße. Er wird durch die Bauform des Brenners begrenzt, da dieser nicht in den Laserstrahl hineinragen darf. Für maximale Einschweißtiefen sind geringe Abstände zwischen dem Auftreffpunkt des Laserstrahls und der verlängerten Brennerachse auf dem Werkstück erforderlich.
Geometrie und Dynamik des Schweißbads werden maßgeblich durch den Lichtbogen und den Werkstoffübergang beeinflusst. Daher ist die präzise geometrische Positionierung des Laserstrahls maßgeblich, um eine effektive Einkopplung der Laserleistung über einen möglichst stabilen Dampfkanal sicherzustellen. Der MSG-Prozess kann mit handelsüblichen Schweißstromquellen sowie in den bekannten Verfahrensvarianten betrieben werden.
Die Plasmen des MSG-Prozesses und eines CO2-Lasers können miteinander wechselwirken, was eine Stabilisierung des Prozesses und eine Führung des Lichtbogens in Richtung der Dampfkapillare ermöglicht.
Beim Einsatz eines CO2-Lasers ist besonderes Augenmerk auf die Wahl der Prozessgase zu richten, die sowohl im Hinblick auf eine mögliche Plasmaabschirmung des Lasers als auch hinsichtlich des Lichtbogens und des Werkstoffübergangs abgestimmt sein müssen. Zusätzlich zur herkömmlichen MSG-Schutzgasdüse kann man eine weitere Gaszufuhr zur gezielten Beeinflussung des laserinduzierten Plasmas verwenden.
Im Falle des Einsatzes von Festkörperlasern zeigt sich ein weiterer Vorteil: Da diese Laser kein eigenes Plasma erzeugen und vom MSG-Plasma nicht absorbiert werden, können Wechselwirkungen vermieden und die Prozessstabilität erhöht werden.
Das Laserstrahl-MSG-Hybridschweißverfahren bietet alle Vorteile der hybriden Kopplung. Besonders herauszustellen ist die einfache und effiziente Zuführung von Zusatzwerkstoff. Dieser erlaubt eine gezielte metallurgische Beeinflussung des Schweißguts und ermöglicht das Überbrücken deutlich größerer Spaltbreiten als beim reinen Laserstrahlschweißen. Die Anforderungen an die Nahtvorbereitung sind dadurch niedriger. Sogar Schnittkanten, die durch Plasmaschneiden, Schlagscheren oder Brennschneiden entstanden sind, lassen sich zuverlässig fügen. Auch Kantenversatz und Unregelmäßigkeiten können mithilfe des Zusatzwerkstoffs ausgeglichen werden. Das Verfahren ist zudem für eine große Bandbreite an Fugenöffnungswinkeln geeignet.
Autor: Lic.jur./Wiss.Dok. Ernst Schneider
Ernst Schneider ist Experte für technisches Recht und Normung. Er berät technologieorientierte Unternehmen und ist Mitglied im Ausschuss Normenpraxis des DIN e.V.
Den kompletten Beitrag finden Sie in „Die Schweißaufsicht im Betrieb“.


